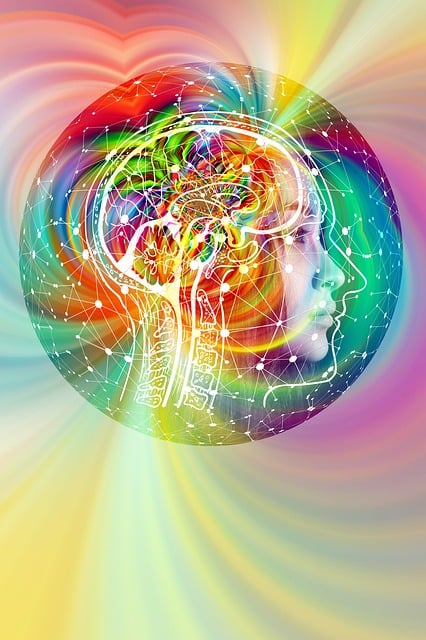
Bernhard Horwatitschs
GEDANKENAKROBATIK
Beiträge aus dem Jahr 2025
7. Beitrag vom 15. April 2025
Drei Reflexionen über Odysseus
1*
Was ein großer Teil der spätindustriellen Konsumenten Leben nennt, ist das Dasein eines nur unzureichend benutzten Automaten. Seit der
berühmten Tat des Odysseus, sich an den Mast binden zu lassen, um so den Sirenen lauschen zu können, ist Beherrschung der Natur gleichbedeutend mit Unterdrückung der Natur, und damit auch der
Unterdrückung der menschlichen Natur. An uns Menschen ist, abgesehen von unserem Körper (und auch der ist zunehmend dem technischen Standard unterworfen) nichts mehr natürlich. Die Sirenengesänge
sind nichts weiter als die Reflexionen unseres Selbst. Ihre Gesänge sind Sinnbild unseres Selbstbewusstseins, unseres Wissens über uns selbst. Dadurch lernten wir Menschen den Geist zu benutzen
und uns selbst zu bestimmen. Doch um uns selbst zu bestimmen, unterdrücken wir in jeder Weise die Natur. Menschlicher Einklang mit der Natur ist eine Illusion, denn es wird immer Natura naturata
(hervorgebrachte Natur und damit Kultur) sein. Im besten Fall kopieren wir die Natur in unseren Gärten, in unseren Produkten. Aber es sind Produkte und keine natürliche, autopoetisch aus sich
selbst erwachsene Natura naturans (hervorbringende Natur). Sie sind gemacht, nicht entstanden. In der Kunst findet man in der ästhetischen Autonomie das scheinbar letzte Refugium einer Einheit
von Mensch und Natur. Das im Schöpferischen sich Gleiten lassen ist hervorbringend und nicht hervorgebracht. Doch inzwischen ist die vollständige „Warenhaftigkeit“ der Kunst mit diesem
schöpferischen Akt in sehr unanständiger, verkrüppelter Art verwachsen. Der träumerische Akt des Schöpferischen verblüht bereits im Moment seines Entstehens. Es ist nicht einmal mehr vorstellbar,
wie etwas sein könnte, ohne eine Ware zu sein. Dieses grundlegend falsche Bewusstsein schlägt hart auf im sich selbst negierenden völkischen Bewusstsein. Selbst Recht und Ordnung sind Produkte
und der Faschist ein Räuber, der sich diese widerrechtlich aneignet. Es bedarf des überrechtlichen, nicht positivistischen Bewusstseins, doch dieses Bewusstsein ist ähnlich träumerisch und
verblüht auf die ganz gleiche Weise wie der schöpferische Akt. Das zeigt sich in allen Politiken spätkapitalistischer Industriegesellschaften. So bleibt nur noch der unbestimmte Begriff einer
normativen Rechtlichkeit. Doch gerade diese Unbestimmtheit verstummt in den Gesängen der Sirenen. So ist es kein Wunder, dass den meisten Menschen das Wachs in den Ohren verwachsen ist und sie
nichts mehr hören können.
2*
O du, der sterblichen sinnlose Sorge / wie mangelhaft sind die Gedankengänge / die dich mit ihren Flügeln tiefer tragen! / der sich mit
Rechtsgeschäften, der mit Medizin / sich plagt und der mit Pfründenwesen / der andre herrschen will, mit List oder Gewalt / der raubt und der betreibt Privatgeschäfte / und jener, ganz verstrickt
in Fleischeslust / müht ab sich, dieser wieder sinkt in Trägheit. (Dante, Paradiso XI,1-9).
Die Ilias ist aus tausend Gründen noch heute ein Epos, das gelesen und bearbeitet wird. Und das nach 3000 Jahren. Das liegt unter anderem auch an der dramaturgischen Konzeption der Retardation. Obwohl wir alle den Ausgang längst kennen, ist es immer wieder spannend. Denn als die Griechen abziehen und nur das hölzerne Pferd als Opfergabe für gute Winde zurücklassen, und den zur Täuschung festgebundenen Sinon, scheint die Stadt im letzten Augenblick gerettet. Diese Momente werden immer wieder durchgeführt. Ein 10 Jahre andauernder Krieg ermöglicht es am besten, retardierende Momente zu zelebrieren. Man könnte das aber auch in eine Beziehung einbauen. Oder in andere Bereiche des Lebens, die ohne Konflikt nicht denkbar sind. Dennoch verehren viele Odysseus und Achilleus als große Helden. Sie kommen in der Rezeption viel zu gut weg. Beide waren Feiglinge, denn sie versuchten sich vor dem Krieg zu drücken. Als er einberufen wurde, gab Odysseus vor, er sei wahnsinnig geworden, trug eine Bauernmütze und führte den Pflug wie ein Bauer. Der Erfinder der Buchstaben und Zahlen, der trojanische Heerführer Palamedes durchschaute Odysseus jedoch und legte dessen Sohn Telemachos vor den Pflug. Odysseus stoppte seinen Pflug und so bewies Palamedes, dass Odysseus nicht verrückt war. Später rächte sich Odysseus an Palamedes, indem er in dessen Zelt Gold versteckte und einen Brief fälschte, indem König Priamos ihm eine Belohnung versprach für den Verrat der Griechen.
Achilleus verkleidete sich als Mädchen und versteckte sich bei den Töchtern des Lykomedes (dem Mörder von Theseus), um nicht in den Krieg zu müssen. Hier war es Odysseus, der die List aufdeckte, indem er Waffen anbot, die den Helden Achilleus anzogen. So wurde offensichtlich, dass Achilleus kein Mädchen war (obwohl er eins war …)
Die Vorgeschichte des Trojanischen Krieges zeigt uns das Urbild
des verhängnisvollen Staatsvertrages. Es war nicht Helenas Schuld, dass sich alle griechischen Könige um sie rissen. Sie wurde schon im Alter von grade zehn Jahren von Theseus entführt. Ihre
Brüder Castor und Pollux befreiten sie. Diese Problematik griff auch Goethe in seinem Helena-Drama auf. Ich schwind hin und werde selbst mir ein Idol, antwortete sie auf die Vorwürfe
Phorkyas, sie spiele mit ihren Reizen. Dann sinkt sie verzweifelt in die Arme ihrer Dienerinnen.
Alle Könige und Königssöhne haben um sie gebuhlt: Odysseus, Achilleus, Menelaos, Antilochus, Agapenor, Sthenelus, Amphimachus, Thalpius, Meges,
Menestheus, Ajax und Patraclos. Sie alle waren kurz davor, einander zu ermorden, um die Hand Helenas zu bekommen. Es war dann der hinterhältige Odysseus, der Helenas Vater Tyndareus vorschlug,
dass alle demjenigen die Treue schwören sollten, der für Helena ausgewählt wird. Für die Eheprobleme, die dem Erwählten mit der schönen Frau, dem Schwan, entstünden, mussten die leer
ausgegangenen Bewerber dem Sieger beistehen. Dieser Vertrag nötigte alle Beteiligten dazu, mit Menelaos in den Krieg zu ziehen. So kam es dazu, dass die vorher und nachher immer miteinander
zerstrittenen griechischen Stadtstaaten sich gegen Troja vereinigten. Ein verdeckter Einsatz von ein paar Elitesoldaten der Spartaner, die Helena aus den Händen von Paris befreien, hätte den
Krieg verhindert. Für so was waren die Spartaner schließlich berühmt.
Odysseus ist völlig zu Recht von Dante in den achten Kreis der Hölle gesetzt worden. Odysseus war einer der schlimmsten Betrüger aller Zeiten. Er war nicht nur Mitverursacher des Trojanischen Krieges (an dem Helena die Unschuldigste ist), er hat mit dem trojanischen Pferd sogar die Götter betrogen. Den Göttern eine Opfergabe vorzutäuschen, die zugleich als Täuschung der Trojaner wirkte, um hinter die Mauern der Stadt zu gelangen – das ist schon ein starkes Stück. Er hat Achilleus hintergangen, indem er ihm vormachte, Priamus habe die vereinbarte Waffenruhe gebrochen. Das brachte dem Achilleus den Tod. Er hat Palamedes einen Verrat angedichtet und bei seiner Steinigung eifrig mitgemacht. Odysseus tötete Astyanax, das Kind von Andromache. Er warf das kleine Kind einfach von der Burgmauer. Und das sind noch lange nicht alle Schandtaten dieses Mannes, der so seltsam verehrt wird. Er war ein Zwietrachtstifter, ein Betrüger und ein Feigling. Man müsste seine Seele schänden, wie Achilleus Hektors Leiche.
Aber so ist die Welt auch heute noch. Allzu bereitwillig verehrt man Arschlöcher und baut den größten Verbrechern an der Menschheit Denkmäler.
3*
Nun wird man mit Odysseus so leicht nicht fertig. Ihn einfach nur zum
Verbrecher zu erklären – das ist wohlfeil. Odysseus ist der Prototyp des Grenzüberschreiters, des Entdeckers unbekannter Welten. Nicht umsonst ließ ihn Dante in seinem 26. Gesang des Infernos
nicht nach Hause zu Frau und Kind zurückkehren, sondern schickte seinen Hyperodysseus zurück ins Meer. So zog ich denn aufs offne Meer hinaus, sogar über die Grenze des Herkules hinaus, wo
sein Schiff dann an einem Berg zerschellte. Dies ist Menschenschicksal. Denn auch Adam überwand die Grenze, die ihm Gott setzte. Im 26. Gesang des Paradiso spricht Dante mit Adam und dieser
erklärt den Sündenfall ganz anders: O du, mein Sohn, nicht war, vom Baum zu kosten / an sich der Grund so schrecklicher Verdammnis / allein die Übertretung des Gebotes. Von Eva ist hier
gar nicht die Rede. Im Original heißt es „Segno“, das Übertreten des Zeichens. Das reimt sich auf Legno, das zerschellende Holz des Schiffes von Odysseus und dies wiederum reimt sich auf Ingegno,
dem inneren Antrieb der Menschen, sich frei zu entscheiden und das Unvorstellbare anzustreben. In Odysseus offenbart sich die Natur des Menschen. Der antike Odysseus durfte sich am Ende noch in
Ithaka ausruhen. Das darf der moderne Mensch nicht mehr. Uns wurde längst alle Ruhe genommen und wir alle treiben auf offenem Meer und zerschellen irgendwann an irgendeinem profanen Felsen. Jeder
wurde sein eigener Entdecker, jeder sucht seinen eigenen Seeweg nach Indien und findet stattdessen ein unbekanntes Land in sich. Der ewige Aufbruch nötigt uns auch, moralische Grenzen auszuloten.
Wir haben uns längst eigene Gesetze gegeben und brechen diese bereitwillig. Naturgesetze sind schon etwas schwerer zu überwinden. Die selbst gesetzten Zeichen sind, seit Nimrod nur verwirrte,
verirrte Worte. Wir bauen weiter Himmelstürme in unserem inneren Sennaar. Was wir hinter das Zeichen setzen, ist aber immer nur ein Komma. Inkommensurable Theorien, die lediglich die Berge
auftürmen, an denen wir zerschellen können. Wir vermehren unser Wissen in permanenter consummata. Alles, was wir beenden, setzt wieder einen neuen Anfang. Was wir hinter uns gelassen
haben, als wir die Grenze überschritten, liegt im selben Moment schon wieder vor uns. Ein gemeinsamer Verzicht darauf, die Grenze zu überschreiten, wäre irrational. Das würde gegen unsere Natur
gehen, gegen unsere Bedürfnisse.
ENDE
6. Beitrag vom 30. März 2025
Phantasien über die Flucht
Der Modus des Luftfluges mit Harfe und Wellgunde liegt im Hinfort und nicht im Hinzu. Doch klärt sich je, wer und wann jemand wirklich flieht? Johannes XXII herrschte als erster Papst durchgehend in Avignon. Noch zwei Jahre vor Amtsantritt des Schuhmachersohns und studierten Mediziners und Juristen aus der Finanzstadt Cahors beschwor Dante in einem Brief an die Kardinäle, einen Italiener zum Papst zu machen, um die Kurie wieder nach Rom zu bringen. Dante beschwor ein Hinzu. Doch die Kirche ging hinfort. Das Pontifikat des Johann von Cahors blieb vollständig in Avignon. Zugleich wurde sein Pontifikat dauerhaft vom Armutsstreit begleitet. Johannes war eher weniger an Armut interessiert. Die Einführung der alchemistischen Münze geht auf eine Bulle des Papstes zurück, in welcher Johannes die Hoffnung ausdrückt, dass einst Blei in Silber oder Gold verwandelt werden könne. Ist nun dieses transmutierte Geld ein Hinzu oder ein Hinfort? Oder sind eher die Spirituellen Flüchtige, deren Armutsschwärmereien ihnen nur den Vorwurf der Häresie einbrachten. Ein Hinzu und Hinfort ist schwer, zu erklären, da jeder Lauf im Rund sein Ziel nur als Konvention kennt.
Sein ganzes Pontifikat lang kämpfte Johannes XXII nicht nur gegen die Reichsgewalt (Ludwig der Baier war sein Lieblingsgegner). Er kämpfte auch gegen die Gewohnheit, dass die Seelen Verstorbener – so sie himmelswürdig waren – zur Anschauung Gottes gelangen durften, schon lange vor dem Jüngsten Gericht. Der Papst hatte tiefe theologische Skrupel. Nicht, ehe alles bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet sei und alle Schuld oder Unschuld genau geklärt wäre durch eben das Jüngste Gericht, möge niemand diese visio beatifica (totale Glückseligkeit durch die Schau Gottes) erleben, noch verdiene diese irgendjemand. War dieser Horror vor der unrechtmäßigen Glückseligkeit ein neurotischer Konflikt des Papstes, der im Geld nur so schwamm? Oder war es eine Flucht hinfort? In seiner apodiktisch-apologetischen Theologie hoffte er für sich selbst in einem letzten, allerletzten Winkel der Gerechtigkeit seine Unschuld zu finden? Und wer sollte Richter sein? Vater oder Sohn? Das Neue Testament hat es nie geklärt. Dem Gläubigen kann es nicht gleichgültig sein, ist der Sohn doch einer der ihren. Doch sie sind nur Geschöpfe des Vaters. Und ist nun dieses kommende Gericht ein Hinfort oder Hinzu? Wird alles Ungerechte nur verschleiert durch die Projektion in die offene Zukunft? Und so wird das Ungerechte hinfort geschafft?
Und zu guter Letzt: Ist meine Beschäftigung mit solchen Dingen, an einem Sonntagmorgen (andere erfreuen sich aneinander im Kreise der Familie oder
im Freundeskreis), ein Hinfort oder ein Hinzu? Welcher der Rheintöchter folgt mein Harfenlied? Oder ist es gar ein zeitloses Über – jenseits von hinzu oder hinfort? Und wer kann das
entscheiden?
ENDE
5. Beitrag vom 15. März 2025
Zwanzig kurze weitläufige Texte über Kafka
1*
Weil Leben und Schreiben bei Kafka eine Einheit bildete, konnte er nur dosiert leben, um schreiben zu können. Seine Schreibenergie hätte nicht
für ein normales Leben ausgereicht. Er hätte das Schreiben im Leben verloren und verlor sein Leben dann im Schreiben.
2*
Man kann Kafka nicht gerecht werden, auch der großartige Rainer Stach mit seiner gewaltigen dreiteiligen Biografie über ihn, wird ihm nicht
gerecht. Das liegt daran, dass dies Gerecht werden, im Material Kafka gar nicht angelegt ist. Verstecke, schrieb Kafka im Jahr 1917 in Zürau, sind Unzählige, Rettung nur eine, aber
Möglichkeiten der Rettung wieder so viele wie Verstecke. Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg; was wir Weg nennen, ist Zögern.
3*
Was hätte er erkennen und schaffen können, wenn er in das Alter seines Freundes Max Brod aufgestiegen wäre? Andererseits! Wären uns dann viele
Texte vorenthalten worden vom selbstkritischen Kafka?
4*
Ich mag keine Biografien. Denn sie verfälschen immer das Leben, das sie zu beschreiben vorgeben. So lese ich bei Reiner Stach die Zeile: „Auch
der Beamte Kafka, der sich aus politischen Diskussionen heraushielt, wo immer es anging, …“. Während ich in der Monografie von Klaus Wagenbach über Kafkas politische Aktivitäten zu lesen
bekomme: „Kafkas Teilnahme an den Versammlungen des Klub mladych (Klub der Jungen), seine Lektüre der Werke von Herzen, Kropotkin und Petr Bezruč und zahlreiche Äußerungen sind weitere
Belege.“ Kafka wird also von Wagenbach ganz anders geschildert als glühender Sozialist, der eine rote Nelke im Revier trug. Die Monografie erschien 1964 und die der Text von Stach im Jahr
2014. Diese 50 Jahre verändern den biografischen Blick und sagen rein gar nichts mehr über die wirkliche Person Kafka aus. Es ist daher sinnvoller, sich an historische Fakten zu halten, ohne sie
zu interpretieren. Das ist allerdings schwer, weil Sprache immer schon Interpretation ist.
5*
Zum Beispiel das Wort „Mensch“, das ein allgemeines Wort ist, oder „Zahl“ oder „Klasse“, was dagegen ist die Wirklichkeit? Eine sich bewegende
dichte Masse, die irgendwie schleichend und sich wieder erhebend auf festem Grund vorantreibt.
6*
In der Auseinandersetzung eines namenlosen Icherzählers mit einem
Dorfschullehrer, der eine Schrift über einen Riesenmaulwurf verfasst hatte, geht es gar nicht um den Maulwurf, und doch ist der Maulwurf das eigentliche Zentrum des ganzen Antagonismus. Dazu gibt
es eine Geschichte aus dem Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes über den Maulwurf. Darin wird geschildert, dass man den Maulwurf zu Unrecht als einen Schädling jagt, man glaube, er würde
die Wurzeln anfressen.
Der Maulwurf in der Geschichte ist in diesem Fall der Jude. Ist er ein Schädling oder nicht. Der Dorfschullehrer verteidigt den Riesenmaulwurf auf seine Weise, sieht sich als dessen Entdecker und fühlt sich von dem Icherzähler, einem Kaufmann, in seiner Ehre beschmutzt. Vor allem, als eine Landwirtschaftszeitung die Schrift des Icherzählers mit der des Dorfschullehrers verwechselt und sich über sie lustig macht. Dass es in der Auseinandersetzung überhaupt nicht mehr um den Maulwurf geht, sondern nur noch um Recht haben und das nicht einmal inhaltlich begründet, sondern lediglich auf der emotionalen Ebene stattfindet, ist der Antagonismus in diesem Text brillant.
7*
Kafka starb an der Lunge. Thomas Mann verlor 60 Prozent seiner Lunge. Von der halben Lunge von Thomas Bernhard ganz zu schweigen. Das Atmen und das Schreiben. Also ich bin mir sicher, dass die
Lunge das eigentliche Schreiborgan ist.
8*
Dem Delinquenten wird mit Nadeln automatisch das Urteil in den Leib
geschrieben. Eine Prozedur von 12 Stunden. Ab der sechsten Stunde wendet sich das Blatt, da tritt Erkenntnis beim Delinquenten ein. Dieses Epiphanie-Erleben des Schuldigen wird ihn nicht retten.
Der alte Kommandant, der diese Maschine entwickelte, war ein Alleinherrscher. Das Urteil war immer zweifellos. Der Offizier, der sich am Ende an die Stelle des Verurteilten auf das Wattebett der
Maschine legt, wollte sich „sei gerecht!“ Auf den Leib schreiben lassen. Doch die Maschine löst sich dabei auf. Damit wird auch klar, dass es Gerechtigkeit nicht gibt. Das unbezweifelbare Urteil
ist nicht gerecht. Damit ist natürlich der Tod gemeint. Das Leben ist grundsätzlich ein Urteil, das sich in den Körper einschreibt. Aber es ist mit der selbstständig arbeitenden Maschine ein
weiterer Faktor dazu gekommen. Das Urteil wird nicht mehr von Menschen vollstreckt. Folter und Hinrichtung sind eine Einheit geworden und die Maschine ist hochfunktional.
9*
Die Zoopoetik bei Franz Kafka ist von einer seltenen Dichte an Tieren. Es wimmelt in seiner Prosa von Pferden, Hunden, Affen, Ratten, Mäusen
und Ungeziefer. Wohl nach Aussage von Dora Diamant hat sich Kafka vor allem in Brehms Tierleben umgesehen, um seine Tiere zu finden und hielt sich auch an die Beschreibungen. Kafka wandte also
modernste Montagetechniken an bei seiner Tierprosa. Es sind aber keine Fabeln im herkömmlichen Sinne, da sie ihre typisch surreale Motivik enthalten. Kafkas Leitmotive sind dabei die Einsamkeit,
soziale Entfremdung, ein ambivalentes Verhältnis zu Hierarchien (oft sind die Tiere subaltern angelegt), sinnlose Aufgaben oder sinnlose Existenz. Kafkas Tiere – ob sie von außen dargestellt
werden oder von innen – sind scheue, forschende, isolierte Wesen. Nur selten – wie in der Erinnerung an die Kaldabahn, sind sie Animetapher für die bedrohliche Gesellschaft. Dort
sind es übergroße Ratten, die sich wie das Militär formieren, und den isolierten Erzähler bedrohen.
10*
Ein Versatzstück (ein absurder McGuffin), das immer wieder symbolische Wirkkraft entfaltet ist Kafkas Koffer,
von Beginn an mit absurder Wichtigkeit aufgeladen, obwohl nichts Großartiges in ihm ist, einer Veroneser Salami, ein paar alte Anzüge, das Foto seiner Eltern - die ihn doch verstoßen haben.
Dennoch ist der Koffer Symbol der alten Heimat, und zugleich trauriges Symbol der Freiheit. Der Koffer wird so immer wieder zum Spiegel der Befindlichkeit Roßmanns. Wenn er von Delamarche und
Robinson achtlos durchsucht wird, wenn er dann bei der Oberköchin im Hotel Occidental ordentlich dasteht, immer wieder ist Kafkas Koffer allein eine ausführliche Betrachtung wert. Es lohnt sich
daher, den Koffer einmal in seiner sprachlichen Bedeutung zu umschreiben. So kommt das Wort Koffer aus dem Arabischen, quffa für Flechtkorb, im jiddischen der Kaffer, und umgangssprachlich im
österreichischen für Dummerchen stehend.
11*
Es gibt in dem Roman zu viele Nuancen, sei es Kafkas Beziehung zu Frauen, sei es sein Vaterproblem, sei es
seine jüdische Herkunft, der er fremd gegenüber stand, als dass man sich auf eine Deutung festlegen könnte. Auch hört man in vielen Textpassagen beinahe prophetisch überzeichnete Verhörmethoden
der Nazis heraus. Es sei nur an die Behandlung des Kaufmannes Block erinnert, oder an den namenlosen Angeklagten im Sitzungssaal. Die Luft ist bei Gericht kaum zu atmen. Man möchte allzu gerne
näher mit dem Gericht in Kontakt kommen, das Bedrohliche des Gerichtes bleibt „numinos“ und ist doch offensichtlich. Die unerklärliche Angst der Angeklagten entspricht so sehr der Angst derer,
die unter Naziverfolgung standen. Auch die merkwürdige Wehrlosigkeit der Angeklagten ist synonym mit der Wehrlosigkeit der Naziopfer. Alles ist unbegreiflich, da die Sicherheit vor dem Prozess im
Widerspruch zur jetzigen Unsicherheit steht. Franz Kafka ist mit diesem Roman ein Zeitmonument geglückt, das geradezu mythologischen Charakter hat. Dies klingt wie ein Widerspruch. Aber mit dem
Widerspruch per se haben wir es in diesem Roman zu tun. Ein chancenloser Widerspruch, eine Paradoxie.
„Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war?“ So fragt sich K. am Ende, doch da legten
sich schon die Hände des einen Mannes über seine Gurgel und der andere Mann stieß das Messer tief in sein Herz.
12*
Die bekannteste Tiergeschichte ist sicher die Verwandlung von Gregor Samsa
in ein Insekt. Es ist eine so oft interpretierte Geschichte, dass ich sie hier nicht auch noch interpretieren muss. Aber klar ist, dass Gregor vom scheinbaren Versorger zum subalternen und
unerwünschten, weil unbrauchbaren Subjekt absteigt. Alle sind am Ende erleichtert, als er stirbt.
13*
Auf dem Naturtheater bekommt jeder eine Rolle zugewiesen, die er spielt. Aber niemandem wird ernsthaft zugetraut, auch der zu sein, den er
spielt.
Walter Benjamin beschreibt den Prozess Kafkas als ein Vergessen. Wohl die größte Sünde ist es, seine Sünden vergessen zu haben. Es ist ein Akt des Ritus, dass am Ende der Aussöhnung die Sünden aus dem Buch des Gedächtnisses gelöscht werden. Dieses Gedächtnisbuch reicht hunderte Generationen zurück. Es sind nicht nur meine Sünden, es sind die Sünden meines Vaters, Großvaters, Urgroßvaters, Ururgroßvaters.
14*
Die Sünden der Väter, die auf den Sohn übergehen. Diese weite Landschaft ist im Brief an den Vater gemeint. Es ist nicht einfach nur sein
Vater, es ist der Typus Vater, der seine Sünden überträgt und die der Sohn im Gedächtnis behalten muss. Vergisst der Sohn diese Sünden, drohen ihm der Prozess und die Verurteilung. Nun übertragen
die Väter auch ihre Sünden des Vergessens auf die Söhne. Die Söhne können nichts mehr davon wissen. Doch die Übertragung ist das Gesetz.
15*
„Was die Korruption im Recht ist, das ist im Denken die Angst“,
schreibt Benjamin. Dabei ist die Angst das, was uns daran erinnert, was wir vergessen haben. Unseren Körper. Damit ist gemeint, unsere Tierhaftigkeit. In Kafkas Welt denken die Tiere nach. Sogar
sind die Tiere die einzigen, die denken. Nun ist die Korruption Verdorbenheit, Vertrauensmissbrauch, Vorteile zu erlangen, auf die kein Anspruch besteht. Angst ist somit Verdorbenheit und Vorteil
zugleich. Mit der Angst bekommen wir einen Zugriff auf unseren tierischen Körper.
16*
Das Gericht läuft der Schuld nach. Wenn jemand außer sich gerät, in Wut, in Rage gerät, sich vergisst, ist das Gericht
zuständig.
17*
Wer sucht, findet nicht. Wer nicht sucht, wird gefunden. Kafka sieht oder fühlt hier einen anderen Such-Begriff als den uns gewohnten. Mehr ein Wollen als ein Suchen … Etwas dazwischen. Ein möchten. Also die höfliche Form des Mögens. Denn die, die etwas mögen, nehmen sich das oft einfach. Diejenigen, die etwas möchten, zaghafter, wie der Amha‘arez, der vor dem Gesetz wartet, werden nicht befriedigt. Sie lassen ihre schamhafte Begierde ganz fallen, um einzutauchen, in das Gesetz. Diese Form der Affirmation meint Kafka. „wird gefunden“, was in dir ist.
18*
In einem chassidischen Dorf saßen einmal zu Sabbath-Ausgang
die Juden beisammen und redeten fröhlich durcheinander. Nur in einer Ecke saß ein ziemlich zerlumpter alter Jude, in sich gesunken, ganz verkrochen im Halbdunkel seiner Ecke, und still. Nun, die
Juden kümmerten sich nicht weiter um diesen dem Lumpenpack selbst entsprungenen alten Mann. Er war ihnen nun wirklich gleichgültig. Während der Schnaps die Runde machte, wurden die Männer immer
fröhlicher und ausgelassener. Da rief einer, denn so einen gibt es immer, die Frage in den Raum, vom freien Wunsch. Kein frommer Wunsch, nein, ein freier Wunsch. „Was würdet ihr euch wünschen,
hättet ihr so einen frei, einen freien Wunsch?“ Die Hände der Männer griffen in die Bärte und kraulten diese, man hörte sie überlegen, grummelnd, und dann sprudelten die Wünsche nur so hervor,
eine neue Hobelbank, viel Geld, einen anderen Schwiegersohn, zwei schöne Frauen statt seiner alten, weniger Arbeit, weniger Schmerz im Fuß, im Knie, noch echte Zähne haben, und viele derlei
Wünsche, mehr als nur ein freier Wunsch. Die Freiheit der Wünsche platzte heraus aus ihnen. Da viel einem, davon gibt es auch in jeder Runde immer so einen, dem viel eben auf, dass der lumpige
Alte in seiner halbdunklen Ecke noch keinen Wunsch geäußert hatte. Der, also der müsste wohl wirklich einen oder viele haben, hat er doch sonst nichts. Widerwillig, beinahe gegen jede Regung,
Aufregung gewappnet, fing der alte Mann an zu reden. Müde wirkte er, hob den Kopf langsam von der Brust. „Ja nun“, sagte er, „ihr wollt es hören.“ Alle nickten und riefen „ja, aber ja, erzähl.“
So begann der Alte zu erzählen. „Ach“, sagte er, „ich wünschte, ich wäre der König eines großen Reiches, läge in meinem schönen Bett mit Seiden, neben mir meine Königin, schöner als die Seiden
selbst.“ Alle nickten, aber der Alte war noch nicht fertig mit seinen Wünschen. „Dann, da liege ich so im Bett, höre ich die Wachen meiner Burg rufen. Sie rufen mich zur Eile, denn meine Feinde
stürmen in einer Überzahl meine Burg, sind schon in die Festung eingedrungen. Mir bleibt keine
Zeit mehr, mich zu besinnen, nackt wie Gott mich schuf, springe ich aus dem Bett, schnappe mir noch im Laufen ein Hemd, nicht mehr, und fliehe über ein geheimes Tunnelsystem in den Wald, alles
zurücklassend, was einst mir gehörte. Ich laufe die ganze Nacht und den halben Tag durch den Wald wie ein gehetztes Tier, und endlich, endlich finde ich ein Gasthaus und seitdem sitze ich hier im
Halbdunkel auf dieser Bank.“ Alle schauen den lumpigen Alten an. Was ist das für eine Geschichte. „Was hättest du jetzt davon?“, rufen alle fast gleichzeitig. „Ein Hemd“, antwortete der alte
Mann.
19*
Es ist immer wieder faszinierend, welche Verschiebungen es ergibt, wenn man die Querverweise liest. Da lese ich bei dem österreichischen
Kunstkritiker Ludwig Hevesi eine Darstellung der Blavatsky. Er schildert sie als "eine Riesin, einen Fleischberg, der immerzu auf der Chaiselongue lag, in größter Schlamperei, in weitem Negligé,
eigentlich ein Talar aus rot und weiß geblümten Waschkattun."
Diese Schilderung hat Hevesi von Friedrich Eckstein, dem Gründer der Wiener Dependance der theosophischen Gesellschaft. Dieser war mit Gustav
Meyrink bekannt und verkehrte auch in den Prager Cafés, in denen sich Franz Kafka aufhielt. So wird klar, wer eigentlich die Vorlage lieferte, für Kafkas herrschsüchtige Sängerin Brunelda in
seinem Amerika-Roman. Es ist amüsant, dass das noch niemals erkannt wurde und so habe ich ein literarisches Rätsel aufgedeckt, das niemanden interessiert, das es niemals in die Lehrbücher
schafft, das niemals über einen möglichen Streifschuss hinaus Beachtung finden wird. Da aber allen Zeitgenossen Kafkas klar gewesen sein muss, wen er meint, wenn er über Brunelda
schreibt:
„Auf dem Kanapee lag die Frau, die früher vom Balkon hinuntergeschaut hatte. Ihr rotes Kleid hatte sich unten ein wenig verzogen und hing in
einem großen Zipfel bis auf den Boden, man sah ihre Beine fast bis zu den Knien, sie trug dicke weiße Wollstrümpfe; Schuhe hatte sie keine .... Zwischen der Türe und den drei Schränken war ein
großer Haufen von verschiedenartigsten Fenstervorhängen hingeworfen“ .... »Wie lang das dauert!«, rief Brunelda auf dem Kanapee, sie hatte beim Sitzen die Beine weit auseinandergestellt, um ihrem
übermäßig dicken Körper mehr Raum zu verschaffen, nur mit größter Anstrengung, unter vielem Schnappen und häufigem Ausruhen, konnte sie sich so weit bücken, um ihre Strümpfe am obersten Ende zu
fassen und ein wenig hinunterzuziehen, gänzlich ausziehen konnte sie sich nicht, das mußte Delamarche besorgen, auf den sie nun ungeduldig wartete.“
Aus der Forschungsabteilung DeBül, (dicke Bücher lesen).
20*
Es gibt ganz sicher Kafka-Spezialisten, die haben alles über Kafka gelesen, wirklich alles, nur eines nicht, Kafka selbst. Bei den Philosophen kommt
diese Art von Sekundär-Spezialismus noch viel häufiger vor. Platon-Kenner, Hegel-Spezialisten, die alle wahre Berge dieser „Literatur über“ gelesen haben und es naturgemäß nicht mehr schafften,
unter diesen Bergen an Kennerliteratur begrabene Originale zu finden und auch noch zu lesen. Oft ist es so, dass man die Originale gar nicht versteht. Dann liest man über die Originale und
plötzlich geht einem ein Licht auf, weil es der Autor so gut erklärt hat, was der andere Autor meinte. Es gibt Schriftsteller, die schreiben ausschließlich für die „Über-Literatur-Autoren“. Das
sekundäre Publikum ist ihnen egal, sie wollen geradezu, dass ihre originellen und schwer zugänglichen Sprachkunstwerke in Sekundärliteratur begraben wird. Es ist ein Ehrengrab. Aber es ist ein
Grab. Oh, diese Grabschänder, die dann alte Klassiker über die viel gesprochen und geschrieben wird, dann ausgraben und Höchstselbst auch noch lesen. Und diese Grabschänder erdreisten sich dann
auch noch, den honorigen Experten zu widersprechen. „Aber ich habe doch selbst bei Platon nachgelesen, was Sie sagen, hat er nie gesagt.“ – „Woher wissen Sie das? Haben Sie alles nachgelesen?
Kennen Sie die Fassung, XY von dem Experten XY der eine Stelle bei XY fand, die darauf verweist, dass Platon so und nur so gedacht hat?“ Die Über-Literatur ist den Originalen längst überlegen,
denn die Originale sind tot. Sie liegen verwest und als halb verstaubte Knochen in steinernen Särgen aus Buchdeckeln fremder Experten. Und immer, immer wenn die heilige Jubiläumsindustrie eine
alte Leiche feiert, ziehen die Experten ihre meßdienernden Uniformen an und reden über. Das Reden über, ist kein überreden. Es ist ein drüber reden, drauf reden, wie
man Erde auf den Sargdeckel schüttet und die Leiche unter schweren Brocken schwarzer Erde begräbt, damit sie nie mehr ihren Eigengeruch verströmen können. Jene Fäulnis die tote Originale
ausatmen, muss aus wissenschaftlich hygienischen Gründen durch analytische Interpretationserde isoliert werden. Niemand, der nicht berechtigt ist, darf jemals die originale Leiche unmittelbar
sehen und spüren, denn das Leichengift ist gefährlich. So durchlaufen die Gifte der Jubilate analytisch homöopathisiert und interpretationsverschüttelt einen Reinigungsprozess, einen
Entgiftungsprozess. Jetzt versteht sie jeder, die komplizierten Originale wurden von den Experten und Überliteraten entzerrt und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Niemand, wirklich niemand
muss sie mehr selbst lesen. Es hat sie inzwischen auch keiner mehr selbst gelesen, weil – wie schon gesagt – die Überliteratur ausreicht und ohnehin lehrreicher und verständlicher ist als jedes
Original.
ENDE
4. Beitrag vom 28. Februar 2025
(drei Gleichnisse von Jesus und ein wenig Dante dazu)
Der Weinberg steht in den Gleichnissen für das Himmelreich, gleichsam das Empyreum genannt, die oberste Sphäre des Himmelreichs. Diese oberste Sphäre galt in früheren Zeiten als unbeweglich. Man nannte sie auch die Himmelsrose. Es ist die Schau Gottes, die Wahrheit selbst. Dort, erst dort ist alle Kontingenz ausgeschlossen. Doch dieses Ausschließen reicht nicht überall hin. In una parte piú e meno altrove. Der unbewegte Beweger (Aristoteles definierte Gott auf diese Weise) reicht nicht überall hin. Mehr oder weniger (piú e meno) glänzt das Reich Gottes.
Im Gleichnis von den Arbeitern auf dem Weinberg (Mt. 20, 1–16) geht der Gutsbesitzer ganz früh auf den Markt, dann noch einmal um die dritte Stunde, um die sechste und um die neunte Stunde. Allen Arbeitern verspricht er als Lohn einen Denar. Ein Denar war eine antike Silbermünze von etwa 5 Gramm Gewicht und entsprach in der Zeit von Jesus etwa 20 Euro heutiger Kaufkraft. Dann geht der Gutsbesitzer um die elfte Stunde noch einmal auf den Markt. So spät? Der halbe Tag ist schon um! Er findet dennoch immer noch Arbeiter, die niemand angeworben hatte. Auch sie schickt er auf seinen Weinberg. Aber im Text steht nichts davon, dass er diesen Letzten einen Denar verspricht. Gehen wir davon aus, dass diese Lücke absichtlich ist. Denn als alle ihren Denar bekommen, murren die ersten darüber, dass sie zu wenig bezahlt bekämen im Vergleich zu den anderen (die ja deutlich weniger gearbeitet haben). Der Gutsbesitzer argumentiert, dass er mit seinem Geld schließlich machen kann, was er will. Der Gutsbesitzer fragt die Unzufriedenen, ob sie neidisch wären, weil er zu anderen gütig gewesen sei. Der Gutsbesitzer zahlt allen den gleichen Lohn! Das ist ungerecht! In der Tat! So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Im Himmelreich (Weinberg) gibt es keine Gerechtigkeit, keine Einteilung von mehr oder weniger! Im Himmelreich gibt es keinen Zaun, keine Ausgrenzung, Abgrenzung oder gar eine Begrenzung. Dass der Gutsbesitzer den letzten Arbeitern nichts verspricht und ihnen dennoch einen Denar gibt, wie den anderen, das ist das Wunder für die armen Seelen. Abwesenheit der Gerechtigkeit ist nicht Ungerechtigkeit! Schließlich war die Wahl der Arbeiter durch den Gutsbesitzer mehr oder weniger zufällig. Im Himmelreich wird die Kontingenz auch durch eine Form der Überzeitlichkeit ausgeschlossen. So stellte schon Dante in seiner göttlichen Komödie die Frage nach der Kontingenz und bekommt von Beatrice folgende Antwort:
La gloria di colui che tutto move / per l’universo penetra, e risplende / in una parte piú e meno altrove. (Paradiso 1, 1–3) Der Ruhm dessen, der alles bewegt, durchdringt das All und erglänzt in einem Teil mehr oder weniger.
Die Materie widersetzt sich. Und in der Ordnung des Universums sind alle Wesen entsprechend ihrer unterschiedlichen Bestimmung (per diverse sorti) ihrem Urheber näher oder ferner und bewegen sich
auf dem großen Meer des Seins (mar deil’essere) unterschiedlichen Häfen zu. So ist es oft, dass die Form unserer Absicht nicht mehr entspricht, weil sich die Materie widersetzt. Das ist das
Problem der Kontingenz und in dem Weinberg-Gleichnis zeigt sich dies in einer überzeitlichen Gerechtigkeit.
Im Gleichnis von den bösen Winzern (Mt. 21, 33–41) spricht Jesus davon, dass die Bauleute einen Stein verworfen haben, den Gott zum Eckstein machte. Das Gleichnis erzählt dramaturgisch eine Geschichte der Eskalation. Sobald eine Grenze gezogen wird, eine räumliche Dimension entsteht, eskaliert die Geschichte. Denn die Bauern wollen in den Besitz des Weinbergs gelangen. Jesus erzählt die Geschichte der territorialen Auseinandersetzung! Der sozialgeschichtliche Hintergrund sind überhöhte Pachtforderungen elitärer Großgrundbesitzer an die jüdischen Bauern. Der Gutsbesitzer selbst ist weit weg. Für die arbeitenden Bauern ergibt sich daraus der Schluss, dass der Weinberg letztlich ihnen gehöre. Wenn wir als Arbeiter in einer Fabrik den Profit für den Industriellen erwirtschaften, fordern wir unseren Anteil. Wenn wir uns „ungerecht“ behandelt fühlen, eskaliert der Konflikt. Vom Streik bis zur Revolution! Sklaverei, Lohnarbeit! Am Ende der Geschichte steht der soziale Konflikt! Recht und Unrecht? Jede Form von Gerechtigkeit, sei es die Forderung des Gutsbesitzers nach seinem Profit (er ist der rechtmäßige Weinbergbesitzer), sei es die Forderung der Bauern, die selbst erwirtschafteten Früchte zu behalten (sie haben schließlich die Früchte erarbeitet), führt am Ende in die Eskalation. Beharrt auf eurem Recht und sterbt alle! Der Stein, der verworfen wurde, wird alle zermalmen!
Der Anfang des Gleichnisses von den bösen Winzern ist entscheidend! Der Gutsbesitzer legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter
aus und baute einen Turm. Er zog einen Zaun, begrenzte das Unbegrenzbare. Die Kelter ist eine Fußpresse, gleichsam die Maschine zur Ausbeutung. Der Turm spricht für die Wehrhaftigkeit, der
territorialen Abgrenzung. Im Thomas-Evangelium fehlt der Racheakt des Gutsbesitzers. Die Geschichte endet bei Thomas offen. So wird bei Thomas der Weinberg auch niemandem weggenommen. Der Sohn
des Gutsbesitzers ist am Ende tot, erschlagen von den Bauern. Erzählt wird nur die Eskalation, die sich durch Aneignung ergibt. Weder für den Gutsbesitzer, noch für die Bauern besteht ein Recht
auf Aneignung. Und selbst wenn man den Zusatz von Matthäus mitliest (das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die erwarteten Früchte bringt), selbst dann
meint dies nur: Die „erwarteten Früchte“ sind für alle da!
So schließt sich der Kreis zum ersten Gleichnis von den Arbeitern auf dem
Weinberg. Jeder bekommt einen Denar! Jeder bekommt die Früchte. Und es spielt keine Rolle, ob du sie erwirtschaftet hast, oder der Grund und Boden sich in deinem Besitz findet. Es gibt keinen
Unterschied zwischen dem Großgrundbesitzer und dem Bauern. Wer einen Unterschied macht, geht unter in einem sozialen Konflikt.
Beatrice belehrt Dante im Paradiso mit den Worten: e sí come veder si puó cadere / foco di nube, sí l’impeto
primo / látterra torto da falso picere.
Abgelenkt von der falschen Verlockung (falso
piacere) wendet man sich der Erde, der Materie zu (l’attera torto) und nicht dem Himmel. Wer also einen Unterschied macht und nicht mehr darauf achtet, dass jeder seine unterschiedliche
Bestimmung hat, wird im sozialen Konflikt zwischen formalem Recht und Rechtsanspruch zermahlen.
Und so ist der „Auserwählte“ im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl (Lk. 14, 15–24) gerade der, der in die Finsternis geschickt wird. Also jener, der trotz der Hochzeit kein passendes Gewand trägt. Auswahl! Das ist Ausgrenzung! Viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt! Im Festsaal sitzen Böse und Gute zusammen. Es gibt in diesem Festsaal keine Gerechten und keine Ungerechten. Dieser Festsaal hat auch keinen Zaun! Daher wurde zuvor alles zerstört, was sich ausgrenzt. Historisch mag dies an die Zerstörung des Tempels von Jerusalem durch die Römer erinnern (Flavius Josephus). Aber das ist nur der historische Hintergrund. Die äußerste Finsternis ist die Prämisse der Parabel. Warum wird dieser eine so bestraft? Hat das Himmelreich keinen Platz für Sonderlinge? Das Individuum ist bereits Abgrenzung, Isolation und damit Ursache des sozialen Konfliktes. Warum aber sucht der König gerade unter den Ausgegrenzten die Reinen? Das ist Proselytentum und damit gerecht oder ungerecht. Je nach Perspektive.
Aber die Zusammenkunft, die Konfluenz auf dem Hochzeitsfest fordert dich selbst als Opfer! Ein Paradoxon! Und so ist das nun einmal mit Grenzen! Hat sich Jesus nicht geopfert? Ist er nicht das Gesicht? Die Ikone? Was also ist mit dem Gast auf dem Hochzeitsmal, der in die äußerste Finsternis geschickt wird?
Spruch 83 im Thomas-Evangelium: Jesus sprach: „Die Bilder [εικών] sind dem Menschen offenkundig, und das Licht in ihnen ist verborgen im Bilde des Lichtes des Vaters. Er wird sich offenbaren, und sein Bild ist verborgen durch sein Licht.“
Das Gleichnis vom Hochzeitsfest sollte man überdenken.
Spruch 107 lautet
Jesus sprach: „Das Königreich gleicht einem Hirten, der hundert Schafe hatte. Eines, von ihnen, das größte, verirrte sich. Er verließ die neunundneunzig und suchte nach dem einen, bis er es fand. Nachdem er sich so abgemüht hatte, sprach er zu dem Schaf: Ich liebe dich mehr als die neunundneunzig.“
Das Hochzeitsfest für die Krüppel und Bettler? Ein Fest für verirrte Schafe. Und der arme Kerl, der kein Hochzeitsgewand trägt? Ein verirrtes Schaf unter verirrten Schafen! Und falsch angezogen! Das soll das Himmelreich sein? Hier wäre noch einmal Dante zu erwähnen und als Hilfsformel Beatrices Belehrungen: perché appressando sé al suo disire, / nostro intelletto si profonda tanto, / che dietro la memoria non puó ire.
Der Geist, der sich in sich selbst vertieft (nostro intelletto si profonda tanto) verirrt sich, verliert seine Erinnerungen, die ihm nicht mehr folgen können (che dietro la memoria non puó ire). Das eine verirrte Schaf, von dem Jesus sprach, hat sich dem genähert, was es am meisten ersehnte (perché appressando sé al suo disire) und das sind wir selbst, als die Wahrheit selbst. Den Kern des Göttlichen in uns können wir nur erkennen, wenn wir vom Fluss Lethe (mythologischer Fluss des Vergessens) trinken und damit das überzeitliche Überrecht erreichen, jenseits unserer sozialen Stellung im irdischen Leben.
ENDE
3. Beitrag vom 15. Februar 2025
Zehn kleine Geschichtsbilder
1*
Friedrich Wilhelm I von Preußen war ein ekliger Tyrann, der gegen nahezu
jede der, in seiner Zeit herrschende Etikette verstieß. Schon als Kind litt er unter unbeherrschbaren Wutausbrüchen und warf seine Spielkameraden direkt aus dem Fenster. Er lernte nie, seine
Affekte zu beherrschen, und seine Zeitgenossen urteilten sehr deutlich und ablehnend über ihn. Später schlug er eigenhändig seine Untertanen, hätte beinahe seinen eigenen Sohn hinrichten lassen.
Friedrich Wilhelm I von Preußen hatte einen geldgierigen Analcharakter, badete sprichwörtlich wie Dagobert Duck, in Goldthalern, Tausende verließen aus Kummer und Sorgen das Land während seiner
Regentschaft. Er ließ Massen junger, großgewachsener Männer aus ganz Europa entführen (seine „langen Kerls“), die er dann, wie Puppen exerzieren ließ. Er war hochgradig misogyn,
wissenschaftsfeindlich und männerbündlerisch und litt unter regelmäßig auftretenden psychotischen Schüben, in denen er noch unerträglicher und ekliger wurde. Er litt an der Erbkrankheit
Porphyrie, die unter inzestuösen Hohenzollern verbreitet war und trotz all dieser Makel haben ihn die Historiker immer sehr wohlwollend behandelt.
Nur eines hat er wirklich gut gemacht: "Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, daß die Advocati wollene schwartze Mäntel, welche bis unter
das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man diese Spitzbuben schon von weitem erkennt."‘
Bis heute tragen die Spitzbuben diese schwarzen Roben und sind bereits von Weitem zu erkennen.
2*
Sie war groß gewachsen, ihr dichtes und hellblondes Haar fiel ihr bis zur Hüfte. Ihre Augen blitzten, ihre Stimme war rau. Ein goldener Torque
zierte ihren Hals. Ein dicker, bunter Mantel bedeckte sie und in ihrer rechten Hand hielt sie einen langen Speer. Boudicca! Sie war die letzte Britin, die sich gegen die Römer wehrte. Immerhin
töteten ihre Briten und Kelten 70.000 Römer bevor sie von dem römischen General Paulinus besiegt wurde. Der Grund ihres Aufstandes war Ungerechtigkeit. Nach dem Tod ihres Mannes, König Prasutagus
meldeten sich römische Gläubiger, bei denen ihr Mann Schulden hatte. Einer von ihnen war sehr bekannt. Der römische Pseudophilosoph Seneca. Besonders abartig an seiner Forderung war, dass er
selbst behauptete sein Reichtum sei völlig in Ordnung und sein Besitz nicht mit Blut besudelt. Das war natürlich – wie bei jedem Reichtum – eine dreiste Lüge.
3*
Auf Drängen seiner Mutter Monica willigte Aurelius Augustinus in die Ehe
mit einer reichen jungen Dame ein. Seine damalige Geliebte, mit der er einen unehelichen Sohn hatte, schickte er wieder nach Afrika. Die wurde dort Nonne. Augustinus gefiel seine Zukünftige sogar
ganz gut. Es gab nur ein Problem. Sie war erst zehn Jahre alt und brauchte noch zwei Jahre, bis sie reif war. Bis dahin musste Augustinus sich irgendwie trösten. Da er seine Geliebte
fortgeschickt hatte, blieb nur übrig, sich eine Zwischengeliebte zu nehmen. Der Kirchenlehrer lebte dreizehn Jahre lang mit dem Vorhaben, einmal keusch zu werden, und liebte daher besonders
innig, weil er ja bald keusch werden würde.
In der Tat steigert es den Genuss, wenn man sich dabei vorstellt, es sei das letzte Mal.
4*
Die berühmte Follia in D-Minor stammt ursprünglich von Corelli. Das Allegro geht an die Grenze accelerando ins Vivace ja geradezu presto und
spielt so mit unseren Gefühlen der Heiterkeit und der Manie.
Bei Vivaldis Version kommt ein genialer Moment dazu, denn das basso continuo dargestellt durch eine Viola da Gamba (bis zum 17. Jahrhundert und das tiefste Instrument) grundiert die ganze heitere
Manie mit einem mesto. Vivaldi gab selbst Unterricht in dem Instrument und was Wunder, dass er es in seine Triosonate einbaute. Corelli und Vivaldi sind Vorläufer darin, die Affekte
ineinanderfließen zu lassen, was im Frühbarock nicht denkbar gewesen wäre. Und es muss für die damaligen Zeitgenossen ein gewisser Schock darin gelegen haben oder auch eine höhere Form der
Befriedigung, der eigenen emotiven Realität in der Musik näher zu kommen.
5*
Als Augustinus von Hippo die peripatetische Lehre des Aristoteles mit der
Stoa von Chrysipp vereinte, nannte er das beim Namen. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier, indem er es beherrscht. Oder um es mit Max Weber zu definieren: Alles Menschliche basiert auf
Ungleichheit. Die Französische Revolution postulierte dagegen die Gleichheit. Und damit: Alles Urrevolutionäre basiert auf Entmenschlichung. Und dann darauf, den Menschen zu unterjochen, um
wieder die Menschlichkeit herzustellen, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Also sicher kein Grund, ernsthaft Teilnehmer einer Revolution zu werden. Das wäre nur dann für das Subjekt lohnend, wenn
es sich vom Unterdrückten zum Unterdrücker wandelt. Und was wäre gewonnen?
Interessanterweise waren die Arschlöcher, die mein Leben kreuzten, durchaus beeindruckend. Der Teufel ist allemal eine größere intellektuelle Herausforderung als das Tier. Wenn die Bibel den Teufel als Tier schlechthin bezeichnet, dann meint sie damit ganz im Sinne der Stoa, dass im Teufel die Verwirklichung des Tieres stattfand, und damit ist dann der Mensch gemeint. Der Mensch ist als vollkommenes Tier dem unvollkommenen Tier überlegen. Nimmt man den Menschen als Teufel, dann ist er in der Tat das Ebenbild Gottes. Als Anti-Gott sozusagen. Der umgedrehte Gott spiegelt sich im Teufel Mensch. Also muss der Teufel Mensch sich selber spiegeln, um wieder zu Gott zu werden. Erkenne, wie böse du bist. Und du wirst wieder zu Gott. Als Anti Bild von Gott hat der Teufel Sinne und urteilt mit ihnen über das Wahrgenommene. Gott tut dies nicht, denn Gott ist das absolut Leblose. Gott ist all das, was nicht ist. Gott ist das, was vor dem Anfang des Universums war. Alles, was nicht ist, ist gut. Ein Stein ist immer noch besser als ein Bakterium. Und ein Bakterium ist immer noch besser als eine Steckmuschel. Aber ein Mensch ist das schlechthin Böse und befindet sich womöglich am anderen Ende der Skala. Der Mensch neigt dazu, alles Lebende zu vernichten und erweist sich damit als das böse Gute oder das gute Böse.
6*
Heute spricht man noch von Vandalismus. Das ist ein Schimpfwort. Aber der Stamm der Vandalen war ganz plötzlich von der Erdoberfläche verschwunden, nach dem die Römer bei ihnen einmarschiert
waren. Bis heute hielt sich aber das Wort Vandalismus. Aber es war ein Völkermord. Es gibt keine Gerechtigkeit. Darunter waren Menschen, Frauen, Kinder, die sich liebten, und wäre die Welt
gerecht, dann müsste man ihre Schreie hören, heute noch hören.
7*
Wenn man sich mit einer Epoche beschäftigt, wird man von einer Überfülle an Details beworfen, wird man in die Ecke getrieben und wehrt, an der Wand
stehend diese ganzen Details wie ein Pingpong Spieler ab. Man möchte ja gerne, ja wirklich, man möchte nur zu gerne eine Erklärung haben, man möchte die Epoche erfassen und einordnen können, aber
es gelingt nicht, weil diese Epoche wie ein prismatischer Spiegel all die anderen Epochen in sich bricht, ein Panoptikum schaffend, das in jeder Epoche das ganze bisherige Sein einfasst und die
Vision zur Zukunft mit dazu.
8*
Zwischen die Wissenskuriositäten stauen sich alle möglichen
Vorstellungen und Fehlinterpretationen, viel Halbwissen und Dummheiten. Ich bin zu 80 Prozent damit beschäftigt, dieses Halbwissen und diese Dummheiten aus meinem Wissenssortiment zu
filtern.
„Entschuldigen Sie“, sagt der Kunde am Wissenskiosk, „das hier ist aber schon abgelaufen.“
„Ach“, sage ich. „Schauen Sie mal, das ist sehr alt. Wissen kann dann wieder schmecken. Es
ist wie mit dem Wein.“
Der Kunde blickt skeptisch. Er möchte nur frische Ware haben. Und ich gebe ihm die neueste Psychologie-Studie, damit er, was zum Kauen hat. Dazu ein paar aktuelle Theorien zum Universum. Der
Kunde bedankt sich und geht glücklich seiner Wege. Das alte, abgelaufene Wissen stelle ich zurück ins Regal.
9*
In einer Ausgabe des
Kursbuches von 1968 zitierte der Herausgeber Karl Markus Michel den sonderbaren Ausspruch eines Studenten: „Unsere Demonstrationen werden immer schöner. Sie hätten sehen sollen, wie wir mit Dany
nach Forbach zogen, mit gelben Ginstersträußen und vielen roten Fahnen.“
Michel kann sein Unbehagen über diesen Ausspruch kaum verbergen. Er schreibt dazu: „Der fast naive Verweis auf Ästhetisches, der dem Problem scheinbar auswich, da er kaum auf eine
Wirkungsästhetik, vielmehr auf eine Ausdrucks- oder Befriedigungsästhetik abhob, gab doch eine Antwort, die das Problem erst richtigstellte: Cui bono?“ Und gestern ein Kommentar von Campact über
eine Demo der Klimaaktivisten: „Die Demonstration war schön.“ Cui bono?
10*
Mitten im Wald in der Nähe eines kleinen Bächleins, umringt von gewaltigen
Eichen, stand eine ärmliche Hütte, erbaut mit eignen Händen von einem noch ärmlicheren Einsiedler. Dieser einfache Mann lebte von Wurzeln und Beeren. Gegen die bittere Kälte schützte ihn nur ein
sackähnliches Kleid aus Wolle, das längst zerfranst und schmutzig geworden war. Ein Trupp Soldaten hatte sich in diesen Wald verirrt und trafen nun auf diesen Einsiedler. Die Soldaten waren
ausgehungert und mordlüstern. Doch sie merkten schnell, dass es sie auch nicht satt machen würde, wenn sie diesen dünnen Einsiedler töten würden. Sein Fleisch schien ihnen
ungenießbar.
Sie baten den Einsiedler, ihnen einen Weg aus dem Wald zu weisen. Das tat der Einsiedler und begleitete die Soldaten zur Dorfgrenze.
Als er allein wieder zurückkehrte zu seiner Hütte, war diese verwüstet worden. Offenbar hatte ein anderer Trupp Soldaten in der Zwischenzeit
gehofft, Essbares oder Bares dort zu finden. Aber außer Bücher und einer Schüssel mit Wurzeln und Beeren hatten sie nichts vorgefunden. Alles war zerstört worden. Der Einsiedler legte sich
traurig in sein durchwühltes Stroh und schlief unruhig ein.
Da träumte er von einem Baum, an dem nicht Blätter, sondern Menschen hingen. Auch die Wurzel des Baumes bestand aus Menschen. Sie litten sehr unter ihrer Last. Der Druck des Menschenbaums presste ihnen sogar das Mark aus den Knochen heraus. All ihre Mühen, den Menschenbaum am Leben zu erhalten, wurden durch Prügel und Not gelohnt. Sie waren Bauern, die aus der Erde holten, was aus der Erde zu holen war. Die untersten Äste über den Bauern waren Plünderer und Diebe, einfache Soldaten wie diese, die auch die Hütte des Einsiedlers zerstört hatten. Das wenige Hab und Gut wurde den Bauern von diesen Plünderern geraubt. Doch die Plünderer waren nur armselige Fußsoldaten, die gottlos von der Hand in den Mund lebten und nicht über den einzelnen Tag hinaus planten. Über diesen Fußsoldaten standen die gelernten Soldaten. Sie klopften die einfachen Soldaten so lange aus, bis sie sich das bisschen Hab und Gut der Bauern selbst aneigneten. Doch über diesen wiederum standen die Kommandanten, die sich auch für was Besseres hielten. Sie prügelten das Hab und Gut aus den gelernten Soldaten raus.
Über all diesen hingen die oberen Äste. Um sie zu erreichen, musste man eine Leiter ersteigen, die allerdings mit einem schmierigen Öl bestrichen war. Das schafften die wenigsten. Fast alle rutschten von der Leiter. Nur diejenigen, die schon einen Verwandten an den oberen Ästen hatten, wurden hinaufgehoben. Ganz egal ob dumm oder klug. So saßen oben fast nur Protegierte. Um den Baum auch unten am Leben zu erhalten, wurde gelegentlich ein klein wenig davon, was man zuvor den Bauern ganz unten genommen und ganz nach oben weiter gereicht hatte, wieder herab geworfen. Doch das kam meist nicht unten an, weil geschickte Leute es noch vorher abfangen konnten. So hungerten die, die unter der geschmierten Leiter standen weiterhin. Dieses System wurde allein vom Krieg selbst am Leben erhalten.
So schildert es uns Christoffel von Grimmelshausen in seinem Simplicissimus. Dieser Traum des Einsiedlers ist bekannt als „Ständebaum-Allegorie“. Die Schere von arm und reich, wächst heute wieder beständig. Sie ist in erster Linie ein Ergebnis der Korruption. Heute sind es wohl keine Bauern, Landsknechte und Pikeniere, die an den unteren Ästen hängen und verhungern. Doch die vielen fleißigen und produktiven und reproduktiven Kräfte unseres modernen Wirtschaftsbetriebs werden weiterhin verarscht. Die geschmierte Leiter ist eine Metapher der Chancen- und Leistungs- und Verteilungsungerechtigkeit. Das Problem ist, dass so ein ungerechter Baum keine Überlebenschance hat. Denn nicht jedes Kind reicher und privilegierter Eltern hat auch Führungsqualitäten. So sitzen in den gehobenen Positionen vielfach Idioten oder Menschen ohne jede Moral. Empathie und Moral sind sogar Eigenschaften, die jede Karriere zerstören. Besser kommt man voran, wenn man Beziehungen hat, diese eiskalt nutzt, sprichwörtlich über Leichen geht und dann muss man nur noch dafür sorgen, dass die, die unter einem sind, weiter unten bleiben. Die geschicktesten unter den Korrupten fangen am liebsten staatliche Fördergelder auf. So kommt das Steuergeld in der Regel nicht den einfachen Leuten zugute, sondern fördert nur die, die ohnehin schon am goldenen Topf sitzen. Das Ergebnis ist, dass Idioten und gefühllose Dreckskerle immer reicher werden, während die intelligente und empathische Basis die alle ernährt allmählich verhungert. Leistung ist nur noch eine Quelle, an der sich Idioten und Schweine laben.
Dies war auch der Grund, warum Simplicissimus nach all seinen Abenteuern in der weiten Welt, wieder in seine Einsiedelei zurück- kehrte, und es ist heute ein Grund dafür, Arbeit und Mühe aus dem Weg zu gehen. Wer schuftet, füttert damit nur Idioten und Schweine.
ENDE
2. Beitrag vom 30. Januar 2025
Staffel 29
1*
Der mittelalterliche Mensch lebte in einer nicht segmentierten, analogen Welt. Sein sinnlicher Horizont bildete eine Einheit. Auge, Ohr und Hand wurden noch nicht als getrennte Entitäten erlebt.
So erlebte dieser frühe Mensch vor 1000 Jahren echte Dauer in unterschiedlicher Form. Der moderne Mensch lebt dagegen in einer linearen, digitalen Welt. Die Sinne sind ihm segmentiert und das
Auge wurde zum Prädator. Der moderne Mensch erlebt eine rasende Schattenwelt. Nichts steht mehr still, alles wurde flüchtig, zerstäubt in tausend Scherben. So ist der moderne Mensch mit all
seiner Elektrizität weit mehr ein platonischer Höhlenbewohner, als der von Aktion und Tempo noch verschonte Mensch vor der Renaissance.
2*
Warum sind Bücher nicht rund oder dreieckig oder sechseckig. Sie könnten auch wie Sterne aussehen. Man könnte sie wie Tassen formen und dann müsste man von oben nach unten lesen.
3*
In seinem Buch „Die Gutenberg-Galaxis“ schreibt Marshall McLuhan: „Der Haken liegt für den nicht-alphabetischen Menschen nicht darin, daß er
unlogisch wäre, sondern daß er die Logik zu häufig anwendet, oftmals auf Grund ungenügender Prämissen. Er nimmt im Allgemeinen an, daß Ereignisse, die in einer gewissen Verbindung stehen, in
einem Kausalzusammenhang stehen. Aber das ist ein Trugschluss, dem auch die meisten zivilisierten Menschen sehr oft zum Opfer fallen, und, wie man weiß, erliegen ihm selbst geschulte
Wissenschaftler! Nicht-alphabetische Menschen neigen allzu stark dazu, in der bloßen Assoziation auch schon eine Kausalbeziehung zu sehen; und gemäß der Regel gilt das als wahr, was
funktioniert.“
4*
Heute beim Spaziergang wäre ich beinahe von einem alten, dicken Mann auf einem Fahrrad überfahren worden. Ich konnte ihn nicht sehen, er fuhr so über die Straße, dass er auf dem Gehweg hinter mir
war und ganz knapp an mir vorbei fuhr. Während ich den in seinen atmungsaktiven und farbenfrohen Fahrradkleidern noch fetter und lächerlich alt wirkenden Mann beobachtete, dachte ich, dass er
hätte klingeln können. Ich habe hinten schließlich keine Augen und ich überlegte mir, was ich so alles hätte noch sagen können, wie zum Beispiel „du fette Sau und blöde“ oder Ähnliches. Also so
dachte ich vor mich hin, als es plötzlich klingelte, und ich schritt zur Seite und ein männlicher Radfahrer mit Bürstenhaarschnitt fuhr an mir vorbei und sagte auch „danke“ zu mir. „Bitte“, sagte
ich kleinlaut und dachte, das ist wohl Gottes Ironie. Der Zusammenhang mit meinem Denken ist zweifelsfrei sakraler Natur und mein Schluss ist daher durchaus logisch.
5*
Viele Menschen können einem Denkprozess nicht folgen, weil ihr eigener Standpunkt sie dominiert.
6*
Die ersten Kaufleute waren wohl Landstreicher, die man als „hôtes“ bezeichnete, als Gäste. Sie drangen in das mittelalterliche, durch das Zunftleben geregelte und damit konkurrenzlose Stadtleben
ein und brachten dieses Zunftleben, die Preise, den Warenfluss durcheinander. Daher mochte man sie nicht. Es waren immer wieder auch Juden unter diesen frühen Kaufleuten.
7*
suchen wir nach Maßstäben, die wir als Realität begreifen können, gibt es wohl drei Gruppen zu untersuchen. Einmal gibt es universale Annahmen, die allen Wissensgebieten übergeordnet erscheinen,
wie den Satz der Identität, der Widerspruchsfreiheit, elementare Annahmen über Raum und Zeit, seiner Dreidimensionalität, dass Zeit nicht umkehrbar ist, kausale Zusammenhänge, keine Wirkung ohne
eine Ursache, aus nichts kann auch nichts werden. Kurz wir könnten das die formalen Basispostulate nennen. Fantastisch wären dagegen die Doppelgängerphänomene der Literatur, von höheren
Dimensionen zu erzählen, oder von Ereignissen, die keine Ursache kennen, von Dingen zu erzählen, die plötzlich da sind oder plötzlich verschwinden.
8*
Alles, was ontologisch in unseren diversen Teilrealitäten existiert, direkt oder indirekt sinnlich wahrnehmbar ist, an Materie gebunden, empirisch
als real gilt, wäre eine weitere Gruppe von Basiswissen. Gespenster, Außerirdische, lebendige Roboter, wären hier die fantastische Welt.
9*
Und als dritte Gruppe wären die nicht formalen Universalien zusammenzufassen, die Gesetze der Natur, Schwerkraft, biologisch-chemische
Entitäten. In der Luft schwebende Wesen, Wasser das sich plötzlich in Stein verwandelt, Feuer, das keinerlei Verbrennung verursacht oder sogar kalt ist.
10*
Ach Gott. Heute in einem Vortrag das Bild von Julio Cortazar gesehen, mit seiner Kippe im Mund. Das hat so Lust gemacht.
11*
Wir haben den Helden und blicken auf diesen Helden. Hält sich der Held an die Naturgesetze, sind wir im mimetischen Bereich, hält er sich nicht an die Naturgesetze, sind wir im Mythos oder im
Märchen.
12*
ein irischer Geschäftsmann, eine russische Spionin und ein weißbärtiger Yankee-Colonel gründeten vor 150 Jahren eine spirituelle Gesellschaft, die
auf Dogmen und Glaubensbekenntnisse verzichtet, deren Hauptinteresse es ist, die Bruderschaft aller Lebewesen in einem unendlichen Universum zu feiern und die Geheimnisse dieses Universums zu
erforschen. Viele bedeutende Künstler wurden bald Mitglied dieser Gesellschaft, die Kirche verteufelte sie natürlich und die Nazis verboten sie.
13*
Liest man das Porträt, das der österreichische Kunstkritiker Ludwig Hevesi von Blavatsky abgab (dieser schrieb es auf der Grundlage von Schilderungen Friedrich Ecksteins), dann wird einem klar,
dass die Darstellung der herrschsüchtigen Sängerin Brunelda in Kafkas Amerika-Roman ganz offensichtlich eine Satire auf das berühmte russische Medium des 19. ten-Jahrhunderts ist.
14*
Es ist die Macht des Staates, die ich dabei fühle. Seine eiserne Faust drückt mich zu Boden. Mein Widerwille gegen diese Steuererklärung ist mein Widerwille gegen diesen Staat.
15*
Platon zählte zu den Vornehmsten unter den Griechen. Sein Vater Ariston war mit Periktione verheiratet. In beiden Familien waren schon die Vorfahren eponyme Archonten, also Hüter der Familie,
Vorsitzende des Gerichts, Leiter der Dionysien. Platon stammt damit aus einer politik-erfahrenen Familie. Seine Idee, endlich einmal kluge und weise Herrscher einzusetzen, als die üblichen
Idioten wie sonst, dürfte also auf Erfahrungswerten basieren. Doch bis heute wurde seine Idee nur sehr, sehr selten umgesetzt. In unserer Demokratie entscheidet die Mehrheit, wer regiert. Und
leider ist die Mehrheit der Menschen weder klug noch weise.
16*
In dem Talmud-Traktat „Pirqe Avot“ (Sprüche der Väter) wird die Ethik abgehandelt. Im zehnten Abschnitt des fünften Kapitels heißt es: Sieben Dinge
kennzeichnen den Ungebildeten und sieben den Weisen: Der Weise spricht nicht vor dem, der ihn an Weisheit übertrifft; er fällt einem andern nicht in die Rede; er antwortet nicht voreilig; er
fragt bestimmt und antwortet entsprechend; er spricht über das Erste zuerst und über das Letzte zuletzt. Von dem, was er nicht versteht, sagt er: „Ich verstehe es nicht“: er bekennt die
Wahrheit.
17*
Das Wort „Golem“ ist im modernen Iwrit eine Bezeichnung für alles Unfertige, auch Ungebildete. Das nicht Gebildete, Formlose ist damit gemeint. Die Sage von Golem mit dem geheimen Zettel mit
einer magischen Zahl belebte den Golem und unterstellte ihn dem Willen seines Meisters. Im Prinzip ist das nichts weiter als eine Metapher für das, was Aristoteles als „techne“ bezeichnete. Die
Kunst im Gegensatz zur Natur. Die Natur entsteht aus sich selbst heraus und alles andere, das, was gemacht wird von jemandem oder von etwas, ist Technik.
18*
Das älteste kabbalistische Buch, Sefer Jetzira, stammt aus der Feder von Abraham, also wurde es vor etwa 4000 Jahren geschrieben. Es dokumentiert
sozusagen die Entstehungsgeschichte der Schrift, der 22 hebräischen Buchstaben und löste das Hellsehen der alten Menschen durch gedankliche Begriffe ab. Als noch keine phonetische Schrift
vorhanden war, waren Gegenstand und Zeichen noch magisch vereint. Da sie allein in einer dialektischen Verbindung standen. Der Begriff wurde dann durch die phonetische Schrift erschaffen und
löste die Zeichen vom Gegenstand. Auch die Sephiroth, die zehn magischen Zahlen werden dort von den Gegenständen segregiert. Dadurch ermöglichte man überhaupt erst die Technik.
19*
Baruch de Spinoza sagte einmal, dass ein Pfeil, der sich mitten im Flug seiner selbst bewusst werden würde, glaubte, er flöge aus freien Stücken.
20*
Der im elften Jahrhundert lebende und forschende, jüdisch-spanische Mystiker Soloman ibn Gabirol erschuf einst einen weiblichen Golem, eine
Frau die ihm als Dienstmagd behilflich war. Er wurde daraufhin von dem herrschenden Berber Zawi Ibn Ziri der Zauberei angeklagt. Bei der Gerichtsverhandlung zerlegte Solomon ibn Gabirol die
künstliche Frau wieder in ihre hölzernen Einzelteile und bewies dem Gericht damit, dass es sich lediglich um einen Automaten gehandelt hätte und keine Fleisch gewordene unrechtmäßige
Beseelung.
21*
Das ist ein Fakt, der mich zunehmend isoliert. Die Dummheit. Schlimm dabei ist immer wieder die Tatsache,
dass dumme Menschen ihre eigene Dummheit nicht wahrnehmen können. Sie können es nicht. Sie machen das ja nicht absichtlich. Dumm will keiner sein und für dumm gehalten werden will auch keiner.
Aber für den Wissenden (wenn das überhaupt möglich ist, das binär zu gestalten), ist es unerträglich, nicht verstanden zu werden, wenn er auf das Verstandenwerden angewiesen ist.
22*
Aber im Grunde will ich nur noch philosophische Betrachtungen lesen und mich mit sonderbaren Seins-Phänomenen beschäftigen. Ich will von dieser Welt nichts mehr wissen. Sie dient mir bestenfalls
noch als Gleichnis – um Goethe zu zitieren. Diese Welt mit ihren ganzen Ärgernissen, ihren Kleinigkeiten, die man zu Riesen aufpumpt, diese Welt mit ihrer immerzu dem Kindischen Recht gebenden
Haltung, diese auf Attitüden, auf Täuschungen, auf Lautes und Buntes, auf das Offensichtliche gerichteten Aufmerksamkeit. Ich bin ihr einerseits überdrüssig, andererseits hörig. Überdrüssig bin
ich der Realität, denn die ist betrüblich. Hörig bin ich der Vorstellung von ihr, denn die Phantasie ist immer hochwertiger und feinsinniger. Realität ist dumm und unkontrollierbar. Phantasie ist
geil und von meiner eigenen Vorstellungskraft steuerbar.
23*
Ich gehe unter in einer Massengesellschaft quasselnder Idioten, die sich für wichtig halten. Ich bin so gleich wie die meisten. Was mich zerreißt, was mich zerstört, ist die Option meines
Untergangs. Und ich habe – verdammt noch mal – mehr verdient.
24*
Immerhin kann ich von meinem Kopf leben. Und ich habe ein paar Eindrücke gemacht, auf dieser so merkwürdigen Erde.
25*
Inspiration kostet Leistung und Leistung kostet Inspiration. Das ist ein Fehler in der Schöpfung.
26*
Die kataleptische Phantasie, das heißt die festhaltende, feststellende Vorstellung ist eine Eigenleistung des mit Vernunft begabten Menschen. Wer alle Wahrnehmungen gelten lässt, hat nur eine
Meinung (doxa). Die Arithea, die Wahrheit, ist eine Differenz, die durch die Vernunft entsteht.
27*
Das Fatum machte den Christen im Barock viel Kopfzerbrechen und Justus Lipsius musste dazu ein wenig in die Trickkiste greifen, indem er Gottes Handeln als frei darstellte. So partizipieren wir
Menschen an der Freiheit Gottes, auch wenn wir selbst nicht frei sind.
28*
Chrysippos von Soloi (Soldi ist eine türkische Hafenstadt) folgt auf Kleanthes. Chrysipp ist ein Logiker und seine Tropen waren wegweisend für den modernen Pragmatismus.
29*
Die Semiotik ist die Beziehung der Zeichen zu den Zeichen. Die Semantik ist die Beziehung der Zeichen zu den Dingen und wurde lange nicht ernst genommen. Der Pragmatismus ist die Beziehung der
Zeichen zu den Bezeichnenden (modern: Signifikat zu Signifikant) und die Stoa hat diese Beziehung überhaupt erst wahrgenommen – in der Frühzeit des phonetischen Alphabets.
30*
Wenn es Tag ist, ist es hell. Dieser Konditional (wenn-dann) ist zwar
einfach, aber universal. Darauf folgt die Affirmation hell gleich Tag und die Negation nicht hell – kein Tag. So kann es niemals zugleich hell sein und Nacht, das wäre die Disjunktion, denn Tag
und hell hängen als Konjunktion zusammen. Daher schließen sich Tag und dunkel gegenseitig aus, bzw. hell und Tag schließen einander ein, das wäre die Alternation.
ENDE
1. Beitrag vom 15. Januar 2025
Zwischen Politik und Ökonomie
Teil I
1*
Der Staat
ist nicht die Ursache, sondern nur das Instrument der Herrschaft.
2*
Das
politische Gemeinwesen könnte so schön sein, wenn man jeden das tun ließe, was seiner Natur entspricht und er oder sie sich voll einbringen könnte. Aber die herrschende Ökonomie verlangt und
erpresst in uns den Ackergaul. Dieser Kapitalismus macht damit alles hässlich. Überstreut dies Hässliche mit einem Zuckerguss. Hat man erst den Zuckerguss abgeschleckt, kommt der widerwärtige
Geschmack dieser Ökonomie zum Vorschein.
3*
Der hybride Polypragmatismus der Legislative schwächt den Mut der Exekutive. Oder einfach formuliert: Je mehr Gesetze gemacht werden, desto verwirrter wird der Polizist bei der Arbeit. Polizisten
sind ja keine komplizierten Schachtelwesen. Die geteilte Gewalt aber, die wurde hier kastriert. Und auf der anderen Seite sitzen im Bundestag fast nur noch Juristen, so dass die Legislative zur
Lobby-Veranstaltung der Judikativen wurde.
4*
In dieser unsäglichen und unsäglich schwachsinnigen Diskussion um Integration, sagen besonders wehrhafte und kritische Leute gerne, dass die Einwanderer (die
Ausländer, Zuwanderer, Wahl-Deutschen, die Fremden halt) oft nach Jahren noch nicht „angekommen“ sind. Hallo? Das ist überhaupt nicht deren Interesse. Wir alle sind Einwanderer und wir kommen
nicht an, sondern gehen bald eh wieder. Inzwischen verändern wir den Ort, an dem wir sind. So werden Sie wohl kaum die Einrichtung übernehmen, die Ihr Vorgänger in der Wohnung hatte. Sie bringen
Ihre eigenen Möbel mit oder kaufen sich Neue. Und so ist der Mensch nun mal. Er verändert die Welt in der er sich befindet. Manche tun das nur ein kleines bisschen, andere hauen voll drauf.
Integration ist also das komplett falsche Wort. Es geht eher darum, ob wir die Wohnung gemeinsam einrichten wollen, oder nicht. Wenn nicht, dann ist das eben ein Wettkampf um Blut und
Boden.
5*
Zuweilen
schlägt der menschliche Herdentrieb in Kannibalismus um. Denn nichts erträgt die Herde weniger, als ein Schaf, das eigene Wege geht, sich von der Herde entfernt, die Herde meidet. Dann versucht
die Herde das verlorene Schaf mit aller Gewalt wieder in die Herde zurückzudrängen. Gelingt dies nicht, wird das verlorene Schaf von den eigenen Artgenossen gefressen. Auf diese Weise wurde es
der Herde wieder einverleibt. Es ist oft diese widerwärtige Neigung, die mich die Menge fliehen lässt. Und genau diese Reaktion verursacht dann die zu fliehende Neigung der Menge. So fühlt sich
der Eremit zuweilen als Gejagter. Und um nicht gefressen zu werden, ist der Eremit gezwungen, Gift auszusondern. Je hässlicher, je giftiger er wirkt, desto größer ist sein Schutz vor den
Kannibalen. So sind die, die das Hässliche fliehen nicht selten selbst sehr hässlich.
6*
„Es gibt immer einen verdammten Aufsichtsrat“ (Mrs. S. in Orphan Black).
7*
Der
Unternehmer ist jemand, der etwas unternimmt. Der Arbeiter ist jemand, der etwas arbeitet. Wenn der Arbeiter etwas unternimmt, muss der Unternehmer arbeiten. – Eintrag in einem
Schulbuch.
8*
Es ist
nachvollziehbar, warum manche sich einen König zurückwünschen. Ein König repräsentiert absolute Unbestechlichkeit, denn da ihm alles gehört, kann man ihm nichts geben. Damit ist der König
außerhalb. Er macht keine Geschäfte, mit ihm macht man keine Geschäfte. Das vermittelt Kontinuität. Mit dem König ist man niemals quitt. Man kann ihn auch nicht einfach abwählen, wenn man seiner
überdrüssig ist. Demokratische Politiker nimmt man irgendwann nicht mehr ernst, weil man sie ja loswerden kann, wenn man sie loswerden will. Die Gemeinschaft muss sich nur darüber einig sein.
Deshalb wird ein demokratischer Politiker immer auf ein Geschäft eingehen. Mit demokratischen Politikern wird gefeilscht. Ein Wahlergebnis ist eine Art Geschäftsabschluss. Man hat eine Regierung
gekauft. Von der verlangt man nun, dass sie funktioniert. Funktioniert sie nicht, wird man versuchen, sie zu tauschen. Der moderne demokratische Staat kann daher niemals den Kapitalismus
kontrollieren, denn er funktioniert nach den technischen Operationen des Kapitalismus. Der Ochse, der den Karren zieht, kontrolliert den Karren nicht. Daher bilden sich in jedem
demokratischen Staat Wirtschaftskapitäne, die sich durch ihren Reichtum qualifizieren und aus dem allgemeinen Tauschhandel herausnehmen. Könige des Geldes.
9*
Man wird entweder vom System definiert, oder von der Art, wie man sich gegen das System wehrt.
10*
Er wollte kein Geld, diesen Satz schrieb Joseph Roth vor 100
Jahren über einen alten Militärarzt, der einen todkranken Russen untersucht hatte. Eine besondere, fast beiläufige Tugend. Roth verschweigt uns die Gründe dafür, warum der Militärarzt kein Geld
annehmen will. Weil er den Russen nicht heilen kann, nur seinen baldigen Tod prognostiziert? Es ist die einzige und auch die beste Erklärung. Eine Tugend, nebenbei mit der Hand weggewischt. Heute
unvorstellbar. Jeder Arzt muss abrechnen. Es klingt wie Rache nehmen, offene Rechnungen begleichen.
11*
Es ist die
gleiche Inkongruenz der politischen Maschine, die einerseits Klimakonferenzen abhält und andererseits die Erdöllobby protegiert. Es ist die gleiche politische Maschine, die Steuersünder belohnt,
wenn sie es geschickt anstellen und die ehrlichen Steuerzahler bestraft. Es ist die gleiche politische Maschine, die staatliche Wohnungsbestände verhökerte und mit einer insuffizienten Mietbremse
ein moralisches Alibi installierte.
12*
Es ist
egal, auf welcher Seite man steht, wenn man kein Aktionär ist.
13*
Fakt ist, dass die Medienlandschaft für nahezu jede Meinung ein Format bietet. Nur haben wir eine Wirtschaftsordnung
vorliegen, die selbstreferenziell ist und Meinungen als Waren verkauft. Das Problem ist also nicht eine moralische Frage, sondern eine ökonomische Frage. Was sich als Meinung gut verkaufen lässt,
ist nicht notwendigerweise auch wahr und gut. Sie lässt sich nur „gut“ verkaufen.
14*
Die Erde gehört niemand, ihre Früchte gehören allen, sagte vor 650
Jahren der englische Priester John Ball. Er trat ein für soziale Gleichheit aller Menschen und forderte die Aufhebung der Standesgrenzen. Sein berühmtester Ausspruch lautete: „Als Adam grub und
Eva spann, wo war da der Edelmann?“ John Ball wurde im Beisein des Königs erhängt, ausgeweidet und gevierteilt.
15*
Sie hält
ihren Kontostand ernsthaft für eine Form der Emanzipation.
16*
Auch wenn
man eine Gruppe von Menschen – genannt Volk – zu einem abstrakten Souverän macht, gewährleistet dies nicht, dass sie sich an das Gesetz halten. Vielmehr machen sie Gesetze nach Interessenslage.
Die so hoch gelobte Demokratie ist im Grunde eine Kuriosität. Der ihm unterstellte Allgemeinwille ist lediglich die Allgemeinheit der selbstsüchtigen Interessen.
17*
Wir müssen
dringend die Reichen durch Steuern erleichtern, bevor sie unter ihrem Reichtum zusammenbrechen.
18*
Viele
verwechseln Freiheit mit Freizeit.
19*
Was sind
Leistungsträger eigentlich für Leute? Es sind Leute, die Leistung die andere erbracht haben auf ihr Konto auf den Kaiman-Inseln tragen. Leistungsträger sind damit Leistungs-Wegträger,
Strauchdiebe, Halunken.
20*
Sie
vergöttern die Autorität und hassen sie zugleich, wenn sie sich entzaubert. Der Kleingeist will an jemand glauben. Er ist ein verstörendes Nebenprodukt der Aufklärung. Ohne Gott gibt es keine
Gläubigen mehr, nur noch Fans.
21*
Es ist
nicht die Demokratie mit der etwas nicht stimmt, sondern etwas stimmt nicht mit den Eigentumsverhältnissen.
22*
Der Mensch
von heute besitzt ca. 10.000 Dinge von denen vielleicht 100 wirklich nützlich sind. 9.900 Dinge sind reinster und nutzlosester, ja sogar schädlichster Plunder auf den die meisten Menschen dennoch
nicht verzichten können. Die meisten Konflikte zwischen den Menschen scharen sich um diesen nutzlosen Plunder von 9.900 Dingen. Doch wollen wir wirklich in der Steinzeit leben und mit diesen 100
wirklich nützlichen Dingen dahinvegetieren? Insofern ist Konsumverzicht die falsche Antwort auf die Umweltfrage.
23*
Politik
ist für mich inzwischen eher eine Beschäftigung als würde man mit Kot spielen.
24*
Die
Börsianer werden wie eine außerirdische Population geschildert. Dabei spekuliert doch schon jeder zweite Bankkontenbesitzer mit Aktien und bereichert sich an der Ausbeutung anderer Länder. Das
nennt man kognitive Dissonanz.
25*
Warum
nicht eine Mietidee? Man zahlt nur, wenn man tatsächlich in der Wohnung ist. Mich kostet meine Wohnung pro Stunde ziemlich genau einen Euro. Wenn ich eine Stunde spazieren gehe, könnte ich einen
Euro Miete sparen.
26*
Etwa ein
Drittel der Bevölkerung hat sich inzwischen aus dem allgemeinen bürgerlichen Wertekanon verabschiedet. Sie bauen sich ihre eigene private Matrix in der sie Gott und Schaf zugleich sind. Das
ist nicht weiter überraschend, da die Angst immer größer wird bzw. die Kosten für die Verdrängung dieser Angst vor den realen Bedrohungen den psychischen Druck immer mehr erhöhen. Schlicht
gesagt: Die Herde zerstreut sich in Panik. Die Klimakatastrophe erreicht nun auch die reichen Westnationen, Pandemien reduzieren unseren hedonistischen Gewinn, unser Lebensstandard sinkt, am
Arbeitsplatz verrohen die Sitten, die Wissenschaften widersprechen sich, und ohne Religion sind wir metaphysisch obdachlose, traurige Kinder ohne Perspektiven.
27*
Der Kapitalismus ist ein extrem verschwenderisches System, das nicht nur mit der so genannten Umwelt verschwenderisch umgeht,
sondern auch menschliche Ressourcen vergeudet. So wie man alte Bäume bedenkenlos niederfällt, um einem modischen Hochhaus Platz zu schaffen in dem dann auf dem Fließband produzierte Studenten
wohnen, genauso beiläufig stellt man ältere Menschen auf Nebengleise. Die wahren Fähigkeiten die Menschen haben, werden zugunsten einer Massenfabrikation untergeordnet und verkümmern zu Launen
oder bestenfalls zu Hobbys. Eine hochproduktive Freizeitkultur wird verbrannt wie altes Geld.
28*
Im
Vergleich zu feudalen Imperien haben Demokratien doch eine recht kurze Laufzeit.
29*
Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der industriellen Demokratien. So gewaltig ist der Unterschied zwischen Russland und Europa auch nicht, wie man an den Wahlen sieht: Ungarn, Polen, Italien,
Frankreich, England und auch Deutschland haben alle ihre kleinen Putins im Land.
30*
Einen Kanzler zu wählen, der nicht von Gottes Gnaden König wird, sondern durch das Wahlvolk zertifiziert wurde, so einen Kanzler zu wählen basiert auf dem Kreditwesen. Die letzten 75 Jahre
Demokratie sind nur auf Pump. Und ich fürchte, bald müssen wir das alle zurückzahlen.
31*
Obwohl nur noch 12 Prozent der Deutschen an den Kapitalismus
glauben, sind sie derart materialistisch versaut, dass es sogar den Säuen vor dem Menschen graust.
ENDE
Bei all den erfolgreichen Buchautoren, Filmemachern, Musikern, Künstlern und Unternehmern, sind viele junge Menschen geneigt, ihnen nachzueifern. Sie versuchen, es ihnen gleichzutun und beginnen, das Erschaffene dritter zu kopieren. Das ist der erste Fehlschritt eines Newcomers. Er lässt außer Acht, dass gerade die Erfolgreichen, mit eigener Kreativität zu Werke gingen und deswegen erfolgreich wurden. Deshalb unser Aufruf: Gehe Deinen eigenen Weg, verwirkliche Deine Ideen und erschaffe Deine eigenen Werke.
www.pierremontagnard.com
Jaume Borrell 11, 2/2
08350 Arenys de Mar, Catalunya, Barcelona, España
Tel: ++34 688 357 418 (WhatsApp)
E-Mail: info@pierremontagnard.com
